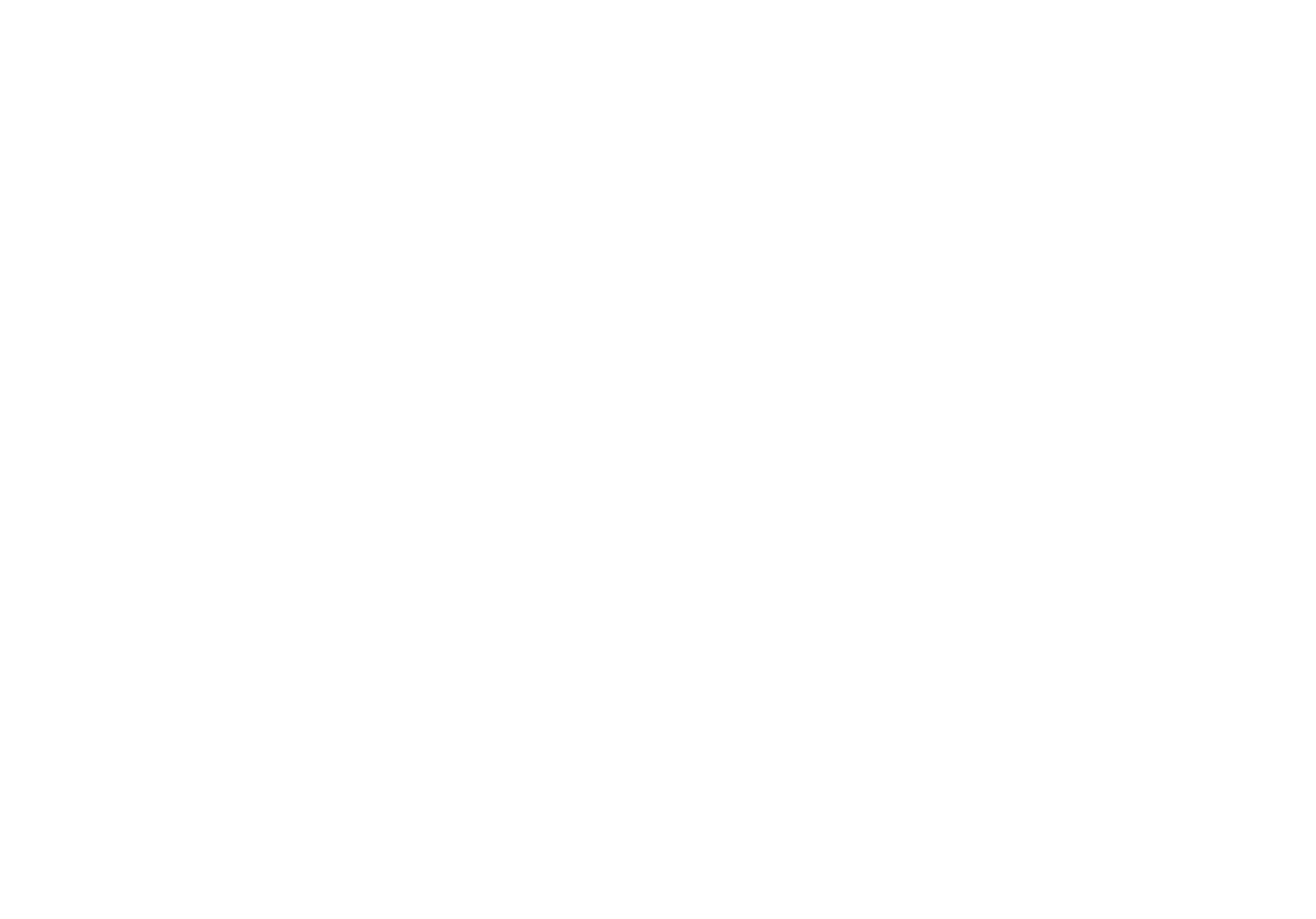Die Sehleistung – auch Sehschärfe genannt – beschreibt die Fähigkeit des Auges, zwei Punkte als getrennt wahrzunehmen. Sie ist ein Maß dafür, wie fein Details erkannt werden können, und wird häufig in Untersuchungen verwendet, um die Qualität des Sehens zu beurteilen.Anders gesagt: Je höher die Sehleistung, desto besser kann eine Person kleine Strukturen oder feine Unterschiede in der Umwelt wahrnehmen.Sie umfasst verschiedene Teilaspekte des Sehens: Das Kontrastsehen, Farbsehen, Bewegungssehen und Räumliches Sehen.
Die Sehschärfe (Visus) gibt an, wie klein ein Objekt noch erkannt bzw. zwei Punkte voneinander unterschieden werden können. Sie hängt vor allem von der Netzhaut, der Linsenfunktion, der Hornhautkrümmung und der Verarbeitung im Gehirn ab.Am Ort des schärfsten Sehens, der sogenannten Fovea centralis (Zentrum des gelben Flecks, auch Makula genannt) ist die Dichte der Zapfenzellen besonders hoch. Dort erreichen Menschen mit gesunden Augen die höchste mögliche Sehschärfe.